Wärmekataster, Wärmespeicherung und Abwärmenutzung
In Deutschland bestehen mittlerweile in vielen Bundesländern, Städten oder Landkreisen Wärmekataster. Das sind graphische Informationssysteme (GIS-basierte Informationen) über Wärmequellen und Wärmesenken.
Wärmequellen entstehen zum Beispiel in energieintensiven Unternehmen wie der Primärindustrie (Eisen- und Stahlhütten), aber auch in Rechenzentren und über den Abwasserpfad einer Stadt. Wärmesenken sind Branchen mit Trocknungs- und Reinigungsprozessen (Klärschlammtrocknung, Tabaktrocknung, Lebensmittelverarbeitung, Krankenhäuser, Lackierung, Kälteerzeugung aus Abwärme) aber auch Nah- und Fernwärmenetze für Heizzwecke.
Wärmekataster bündeln Informationen zu Gebäuden wie Wärmebedarf, Gebäudetyp, Lage, Alter, genutzte Energieträger und Netzanschlusssituation, zu Gas- und Fernwärmenetzen sowie zu potenziellen erneuerbaren Wärmequellen wie z.B. auch Abwärme-Potentialen. Wärmekataster können Investoren als wertvolle Information im Vorfeld einer Ansiedlung dienen, um vorhandene Synergieeffekte zu nutzen. Sie dienen dabei auch Kommunen für die anstehende Wärmeplanung.
 Bild: Ausschnitt aus Wärmekataster-Portal der Stadt Hamburg ©Geoportal-Hamburg/Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg
Bild: Ausschnitt aus Wärmekataster-Portal der Stadt Hamburg ©Geoportal-Hamburg/Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft HamburgWärmenetze können verschiedene Wärmequellen aus Erneuerbaren Energien kombinieren und die daran angeschlossenen Gebäude mit Wärme versorgen. So sind keine kleinteiligen Einzellösungen für einzelne Gebäude notwendig. Ein Beispiel für ein Wärmenetz ist das Fernwärmenetz. Wärmenetze sind in ihrer räumlichen Ausdehnung begrenzt, da sie über die steigende Entfernung von der Wärmequelle zur Wärmesenke an Effizienz verlieren, die Wärmeverluste können bei Nahwärmenetzen bis zu 20% betragen.
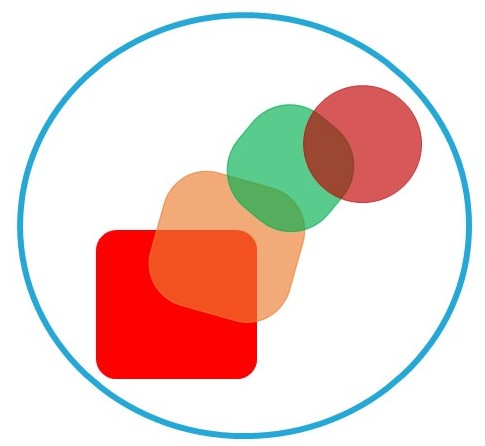 Die in der vorherigen Lektion behandelten Wärmepumpen dienen gemeinsam
mit Wärmetausch-Technologien als technisches Brückenglied, um Wärmequellen mit
einer Nutzung zu verbinden. Denn selten entspricht eine vorhandene Wärmequelle
zeitlich, aber auch vom anfallenden Temperaturniveau her, dem Wärmebedarf eines
Nutzers. Es müssen also Temperaturniveaus gehoben, Wärme über Speicher
oder Rohrleitungen übertragen und Wärme zwischen verschiedenen
Trägermedien (Luft, Wasser, Öl) getauscht werden. Bei diesen Prozessen entsteht
ein Energieaufwand (der Strombedarf der Wärmepumpe) und es geht Abwärme
verloren (Rohrabwärme über die Wand, Abluft von Motoren und Heizungen).
Die in der vorherigen Lektion behandelten Wärmepumpen dienen gemeinsam
mit Wärmetausch-Technologien als technisches Brückenglied, um Wärmequellen mit
einer Nutzung zu verbinden. Denn selten entspricht eine vorhandene Wärmequelle
zeitlich, aber auch vom anfallenden Temperaturniveau her, dem Wärmebedarf eines
Nutzers. Es müssen also Temperaturniveaus gehoben, Wärme über Speicher
oder Rohrleitungen übertragen und Wärme zwischen verschiedenen
Trägermedien (Luft, Wasser, Öl) getauscht werden. Bei diesen Prozessen entsteht
ein Energieaufwand (der Strombedarf der Wärmepumpe) und es geht Abwärme
verloren (Rohrabwärme über die Wand, Abluft von Motoren und Heizungen).
Die Problematik unsanierter älterer Häuser mit
Radiatoren-Heizungen und hohen Vorlauf-Temperaturen, die einen
Wärmepumpeneinsatz zu teuer machen, wurde bereits erläutert. Gegenwärtig werden
Projekte im Bereich der Klärabwässer-Abwärme und Rechenzentren-Abwärme ausgebaut,
weil diese Infrastruktur und damit das Potential überall in den Städten anfallen.
Mobile Wärmespeicher
 Es fehlt momentan an der Bezahlbarkeit von mobilen Wärmespeichern. Diese könnten
beispielsweise in der Eisen- und Stahlindustrie beladen und dann am
Standort Schwimmbad, Turnhalle oder Kulturscheune kontinuierlich entladen werden.
Solche mobilen Wärmespeicher sind Thermo-chemische Speicher, bei denen
Chemikalien (z.B. Silikagele, Zeolithe) Wärme absorbieren.
Es fehlt momentan an der Bezahlbarkeit von mobilen Wärmespeichern. Diese könnten
beispielsweise in der Eisen- und Stahlindustrie beladen und dann am
Standort Schwimmbad, Turnhalle oder Kulturscheune kontinuierlich entladen werden.
Solche mobilen Wärmespeicher sind Thermo-chemische Speicher, bei denen
Chemikalien (z.B. Silikagele, Zeolithe) Wärme absorbieren.
Latentwärmespeicher
ändern bei ihrer Beladung den Aggregatszustand, ein Beispiel ist der
Eisspeicher, der sinnvoll in eine Gebäudeheizung integriert werden kann.
Sensible Speicher sind als Pufferspeicher auf Wasserbasis in den heutigen
Standard-Heizungssystemen integriert.
 (Daten von www.solarserver.de)
(Daten von www.solarserver.de)