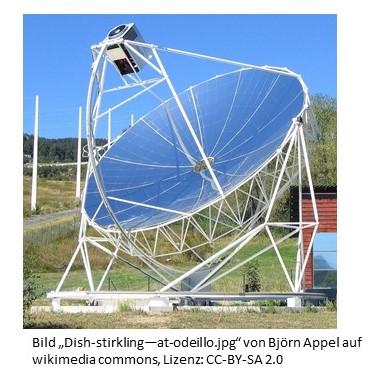Solarfarmkraftwerke sammeln die Wärme in vielen über die
Fläche verteilten Absorbern, meist in einer Linie in Nord-Süd-Richtung (auch Linienkonzentratoren
genannt).
Parabolrinnenkollektoren bestehen aus gewölbten Spiegeln, die das
Sonnenlicht auf ein in der Brennlinie verlaufendes Absorberrohr bündeln. Dort
wird die konzentrierte Sonnenstrahlung in Wärme umgesetzt (Erhitzung auf 400°C) und an ein zirkulierendes Wärmeträgermedium, dem Thermoöl, abgegeben. Die
Rohre führen die Hochtemperaturwärme in einen Speicher (Zwischenspeicher) oder
direkt in einen Dampferzeuger, dem eine Dampfturbine nachgeschaltet ist, ein
Generator erzeugt am Ende Strom. Der Flächenbedarf eines Parabolrinnen-Kraftwerks
liegt zwischen 40-80 m2/kW.
Im Unterschied zum Parabolrinnenkraftwerk werden bei einem Fresnelkraftwerk
die Fresnelspiegel horizontal angeordnet und reflektieren die
Sonneneinstrahlung auf ein Absorberrohr. Das Absorberrohr verfügt über einen
himmelseitig wärmegedämmten Sekundärkonzentrator und eine spiegelseitige
Glasabdeckung. Es wird in ca. 8 m Höhe über den Spiegeln montiert.
Fresnelkraftwerke sind preiswerter, erreichen aber nicht den Wirkungsgrad eines
Parabolrinnenkraftwerkes.
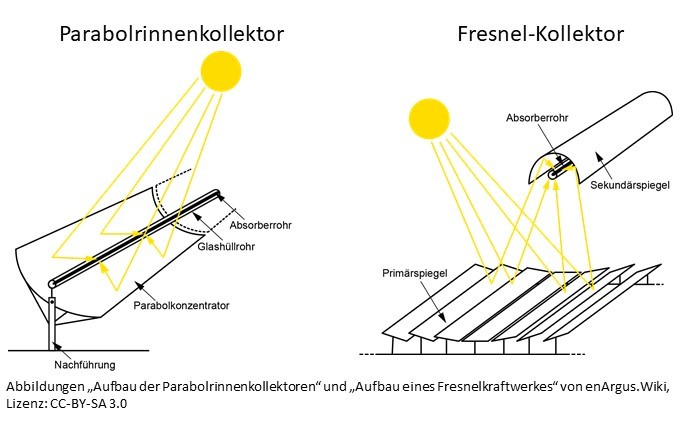
Ein eher kleines solarthermisches Kraftwerk ist eine Dish-Stirling-Anlage.
Zentrales Element ist ein großer runder zweiachsig nachführbarer Hohlspiegel
(Dish, Teller) mit Durchmessern von 10 bis 25 m. In seinem Brennpunkt befindet
sich der Receiver, dessen Wärme über ein Arbeitsgas erwärmt wird, welches in
einem Stirlingmotor zur Expansion gebracht wird. Der Motor treibt einen Generator
an, der Strom erzeugt. Die elektrische Leistung liegt zwischen 10-50
kW pro Anlage mit der Möglichkeit, mehrere Anlagen zu einer „Farm“
zusammenzuschalten. Es können Stromerzeugungs-Wirkungsgrade erreicht werden,
die konkurrenzfähig mit PV-Anlagen sind.