Die Kraft-Wärmekopplung steht an der Schnittstelle zwischen Strom- und Wärmemarkt. Durch ihre hohe Effizienz sind KWK-Anlagen eine tragende Säule der erneuerbaren Energiewirtschaft.
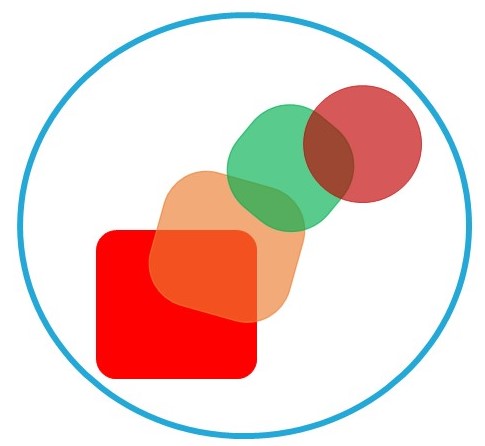
Um den Bau von KWK-Anlagen zu fördern, wurde deshalb zwei Jahre nach dem Erneuerbare Energiegesetz 2002 in Deutschland das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) erlassen. Wesentlicher Teil ist, dass KWK-Anlagen befristet eine Vergütung für den in der Anlage erzeugten Strom, genannt KWK-Zuschlag, erhalten. Voraussetzung der Förderung ist die Zulassung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Nach dem Kraft-Wärmekopplungsgesetz in der Fassung von 2023 müssen KWK-Anlagen ab einer Kapazität von mehr als 500 kWel (minimale elektrische Leistung in kW) bis einschließlich 10 MWel (maximale elektrische Leistung in MW) öffentlich ausgeschrieben werden. Das Ziel ist der Wettbewerb und damit verbunden eine Kostendegression der Anlagen.
Ausschreibung zum Bau von KWK-Anlagen
Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Ausschreibung von Wind- und PV-Anlagen. Zweimal pro Jahr finden durch die Bundesnetzagentur öffentliche Ausschreibungen für KWK-Anlagen statt. Dann wird wie bei einer Auktion im Wettbewerb geboten. Die Gebote müssen sich auf einen bestimmten anzulegenden Wert in ct/kWh KWK-Strom (Gebotswert) und auf eine in Kilowatt anzugebende Anlagenleistung (Gebotsmenge) beziehen. Die Gebote mit den niedrigsten Gebotswerten erhalten einen Zuschlag, bis das Volumen des jeweiligen Gebotstermins erreicht ist (vgl.: Bundesnetzagentur 2024).
Nur Blockheizkraftwerke, die erneuerbare Brennstoffe einsetzen, tragen aktiv zum Klimaschutz bei und haben eine Zukunft.
Auch bei BHKW´s ist bezüglich der Nachhaltigkeit der Brennstoffe zu differenzieren:
- die Verbrennung von Palmöl hat hinsichtlich der damit verbundenen möglichen Regenwaldverluste infolge des Ölpalmenanbaus keine Zukunft.
- Hingegen ist das Verbrennen von Biogas, welches aus Reststoffen wie Gülle und der Biotonne hergestellt wurde, eine nachhaltige Alternative.
Einsatzbereiche von BHKWs
Die Herausforderung der sinnvollen BHKW-Nutzung ist die vollständige Nutzung der Wärme, im Sommer- wie im Winterhalbjahr. Deshalb sind Anlagen im Idealfall am Ort der Wärmenutzung zu errichten.
Die typischen Einsatzbereiche haben BHKW´s in Gebäuden, wo
kontinuierlich über das Jahr Wärme benötigt wird. Dazu zählen Industriebetriebe
mit Prozesswärmebedarf, Krankenhäuser, Kurkliniken, kleine Mehrfamilienhäuser,
Altenheime, Hallenbäder und Schulen sowie Hotels und Pensionen.
Biogas-betriebene BHKW´s bieten eine ideale Voraussetzung für Nahwärmenetze in
der ländlichen Region, wenn öffentliche Infrastruktur (Rathaus, Schulen,
Sporthalle), aber auch Wohnsiedlungen mit Einfamilienhäusern versorgt werden.
Die Beheizung von Einzelhäusern ist dann nicht mehr nötig.
Ein gleichmäßiger Wärmebedarf mit zeitlich parallel
verlaufendem Strombedarf stellt den Idealfall für die wirtschaftliche BHKW-Nutzung
dar. In diesem Fall werden lange BHKW-Laufzeiten erreicht und der produzierte
Strom kann als Eigenstrom genutzt werden.
Der häufige Fall einer
Wärmenutzung aus einem landwirtschaftlich betriebenen BHKW in mitteleuropäischem Klima ist die Beheizung des Fermenters der Biogasanlage
selbst. Denn der Prozessablauf im mesophilen Bereich (35°C) wäre sonst zu
häufig durch zu kalte Außentemperaturen gestört. Alternativ kann die im BHKW
produzierte Wärme auch in ein lokales Nahwärmenetz eingespeist werden oder es
können landwirtschaftliche Trocknungsprozesse unterstützt werden und damit
bisher Erdgas- oder Strom-basierte abgeschaltet werden.
Potential von BHKWs
Mit dem zunehmenden Ausbau von Windkraft und Solarenergie
wird die Bedeutung von Verbrennungs-getriebenen BHKW´s voraussichtlich etwas
zurückgehen.
Ein Grund ist, dass die Rahmenbedingungen gemäß EEG sich für
Biogasanlagen, die nach 20 Jahren Nutzungszeit weiterbetrieben werden sollen
und aus der bisherigen EEG-Förderung herausfallen, verschlechtert haben. Ein
weiterer Grund ist, dass die Stromgestehungskosten von BHKW-Strom auf
Biomassebasis im Vergleich zu Solaranlagen und Windkraft höher sind (siehe Bild
in vorausgegangenem Kapitel). Gasbetriebene KWK-Anlagen mit mehr als 10 MWel-
Leistung müssen ab 2028 auf den ausschließlichen Betrieb mit Wasserstoff
umrüstbar sein.