Übersicht der Erneuerbaren Energien

Zu den Erneuerbaren Energien zählen die:
- Sonnenenergie (Photovoltaik,
Solarthermie),
- Windkraft (an Land, auf See),
- Bioenergie (feste Biomasse
wie Holz, Energiepflanzen, biogener Anteil von Abfällen),
- Wasserkraft (Laufwasser,
Pumpspeicher)
- Meeresenergie (Wellen,
Gezeiten, Strömung)
- Geothermie (oberflächennah,
Tiefengeothermie) und Umgebungswärme.
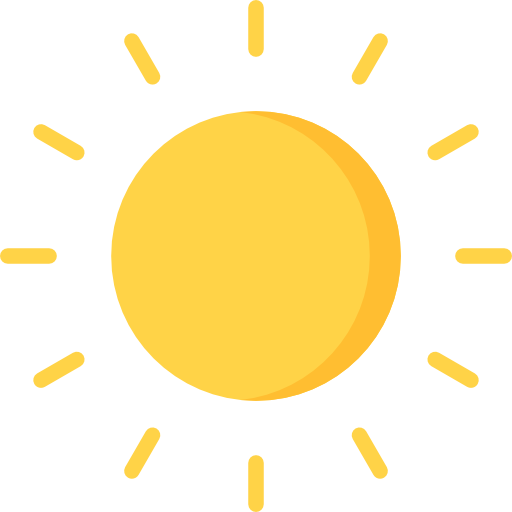 Sonnenenergie
Sonnenenergie
An der Außenhülle der Erdatmosphäre beträgt die Leistung senkrecht einfallender
Sonnenstrahlen im Mittel 1.367 Watt pro Quadratmeter (W/m²). Auf dem Weg durch
die Atmosphäre wird die Leistung durch Reflexion, Streuung und Absorption
gemindert, so dass bei "blauem Himmel" mittags ca. 1.000 W/m²
senkrecht auf die Erdoberfläche einfallen. Dieser Einstrahlungswert von 1 kW/m²
wird als Referenzwert für die Ermittlung der Nennleistung von Solarmodulen
herangezogen. Die Sonnenenergie kann direkt und indirekt genutzt werden. Die
Primärproduktion der photoautotrophen Pflanzen ermöglicht die Nutzung von
Resthölzern oder Energiepflanzen (Biomasse).

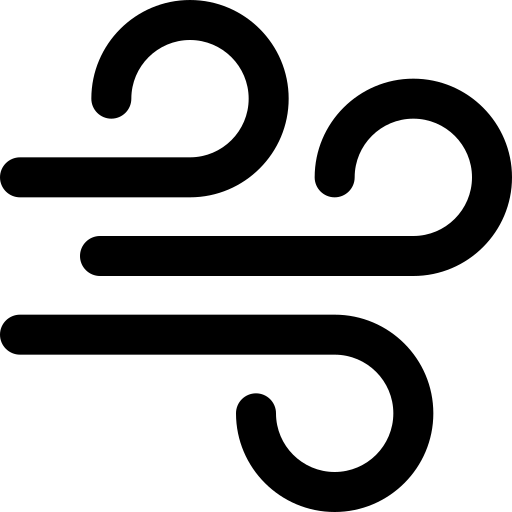 Windkraft
Windkraft
Die Erdatmosphäre besitzt die Fähigkeit aus den
Temperaturunterschieden durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung
Bewegungsenergie, sprich Wind, zu erzeugen. Das Potential an Offshore- (auf dem Wasser) und Onshore- (auf dem Land) Windkraftanlagen ist hoch, eine
neue Studie des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena rechnet eine
theoretische Windkraftleistung auf der Erde von 250 Terawatt (0,5 Watt pro m2),
wenn die ganze Erdoberfläche mit Windkraftanlagen bedeckt wäre (Kleidon 2023).
Bis 2050 wird weltweit ein totaler Energiebedarf an 30 Terawatt prognostiziert,
gegenwärtig werden weltweit rund 0,7 Terawatt mit Windkraft produziert (vgl.: Emeis,
2023: Karlsruher Institut of Technology)
 Wasserkraft
Wasserkraft
Das Potential der Erzeugung von Wasserkraft ist in
Deutschland nicht sehr hoch, weltweit haben aber Flusslaufwasserkraftwerke,
Pumpspeicherkraftwerke sowie Wellenkraft, Gezeiten- und Meeresströmungskraftwerke
eine große Relevanz. Im Jahr 2022 konnten 17,5 Terawattstunden Strom aus
Wasserkraft in Deutschland bereitgestellt werden, das sind rund 3% der
Bruttostromerzeugung (zum Vergleich Windkraft 21,7% und PV 10,5% in 2022). Laut
der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte die Wasserkraft bis 2050 rund 16%
der weltweiten Stromerzeugung abdecken (vgl.: Klimaschutzland Baden-Württemberg PR
Mitteilung vom 29.09.2023).
 Biomasse
Biomasse
Den Vorteilen der lagerbaren Biomasse, z.B. kontinuierlichen
Anpassung an die Heizlast und damit Ausgleich von volatilen Erneuerbaren
Energien, steht der Nachteil ihrer CO2-Emission bei Verbrennung im
Holzhackschnitzelkraftwerk gegenüber. Auch wenn diese grundsätzlich bisher
CO2-neutral bilanziert wurde, so sollen in Deutschland in der Fortschreibung
der Energiewende Technologien gestärkt werden, die Heizenergie durch Grünstrom
bereitstellen (Wärmepumpensysteme) oder wasserstoff-basiert bzw. bioerdgas-basiert betrieben werden. Auch die Fortentwicklung von geothermischen
Systemen und Wärmerückgewinnung aus Rechenzentren und Abwasser wird eine
Reduktion der CO2-Emission von thermischen Biomasseanlagen bringen.
