 In Bioraffinerie-Projekten wurde in den
vergangenen 15 Jahren erfolgreich technisch dargestellt, dass sich eine große
Bandbreite an Plattformchemikalien herstellen lassen, die für alle klassischen
chemischen Synthesewege geeignet sind. Besonders interessant sind die
Ligno-Zellulose-Bioraffinerien, die Abfallholz verarbeiten können und aus dem
im Holz enthaltenen Lignin, der Zellulose und Hemizellulose eine Reihe von
Rohstoffsubstituten herstellen können. Der Rohstoff bzw. Reststoff Holz hat bei
den nachwachsenden Rohstoffen den entscheidenden Vorteil, dass er nahezu keine Landnutzungskonkurrenz
verursacht, wenn vorwiegend Abfallholz und Holz aus der Landschaftspflege
verwendet wird. Bioraffinerien ermöglichen die Erzeugung von Biokunststoffen
auf der Basis von Stärke, Zellulose oder biogenen Ölen. Gegenwärtig gibt es
noch kein passendes Sammel- und Sortiersystem für Biokunststoffe, dieses wird
aber im Rahmen der Forderungen an eine zirkuläre Bioökonomie zusehends
eingefordert.
In Bioraffinerie-Projekten wurde in den
vergangenen 15 Jahren erfolgreich technisch dargestellt, dass sich eine große
Bandbreite an Plattformchemikalien herstellen lassen, die für alle klassischen
chemischen Synthesewege geeignet sind. Besonders interessant sind die
Ligno-Zellulose-Bioraffinerien, die Abfallholz verarbeiten können und aus dem
im Holz enthaltenen Lignin, der Zellulose und Hemizellulose eine Reihe von
Rohstoffsubstituten herstellen können. Der Rohstoff bzw. Reststoff Holz hat bei
den nachwachsenden Rohstoffen den entscheidenden Vorteil, dass er nahezu keine Landnutzungskonkurrenz
verursacht, wenn vorwiegend Abfallholz und Holz aus der Landschaftspflege
verwendet wird. Bioraffinerien ermöglichen die Erzeugung von Biokunststoffen
auf der Basis von Stärke, Zellulose oder biogenen Ölen. Gegenwärtig gibt es
noch kein passendes Sammel- und Sortiersystem für Biokunststoffe, dieses wird
aber im Rahmen der Forderungen an eine zirkuläre Bioökonomie zusehends
eingefordert.
 Große Herausforderungen bestehen bezüglich einer
klimaneutralen Gesellschaft gegenwärtig noch bei der Erhöhung der Effizienz der
Gebäudeenergienutzung (energetische Sanierung), Wärmewende und in der Transformation der Mobilität.
Die Elektromobilität ist für den PKW-Individualverkehr die geeignete
zukunftsfähige Technologie. Um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität weiter zu
erhöhen, werden gegenwärtig Batterierecyclingverfahren optimiert, die bis zu
95% an Rückgewinnung der Batterierohstoffe ermöglichen. Ökobilanzen zeigen die ökologische
Vorteilhaftigkeit der E-Mobilität im Individualverkehr.
Große Herausforderungen bestehen bezüglich einer
klimaneutralen Gesellschaft gegenwärtig noch bei der Erhöhung der Effizienz der
Gebäudeenergienutzung (energetische Sanierung), Wärmewende und in der Transformation der Mobilität.
Die Elektromobilität ist für den PKW-Individualverkehr die geeignete
zukunftsfähige Technologie. Um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität weiter zu
erhöhen, werden gegenwärtig Batterierecyclingverfahren optimiert, die bis zu
95% an Rückgewinnung der Batterierohstoffe ermöglichen. Ökobilanzen zeigen die ökologische
Vorteilhaftigkeit der E-Mobilität im Individualverkehr.
Beispiel
Die aktuelle Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes „Analyse der Umweltbilanz von Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr" zeigt die ökologische Vorteilhaftigkeit des Elektro-PKW: „Das geringste Treibhauspotenzial von 140 g CO
2eq pro Kilometer weist der Elektro-Pkw (mit 55 kWh Akku) auf, der mit Netzstrom fährt. Er liegt … um 41 % unter dem Benzin-Pkw.“(Umweltbundesamt, 2024: S. 103).
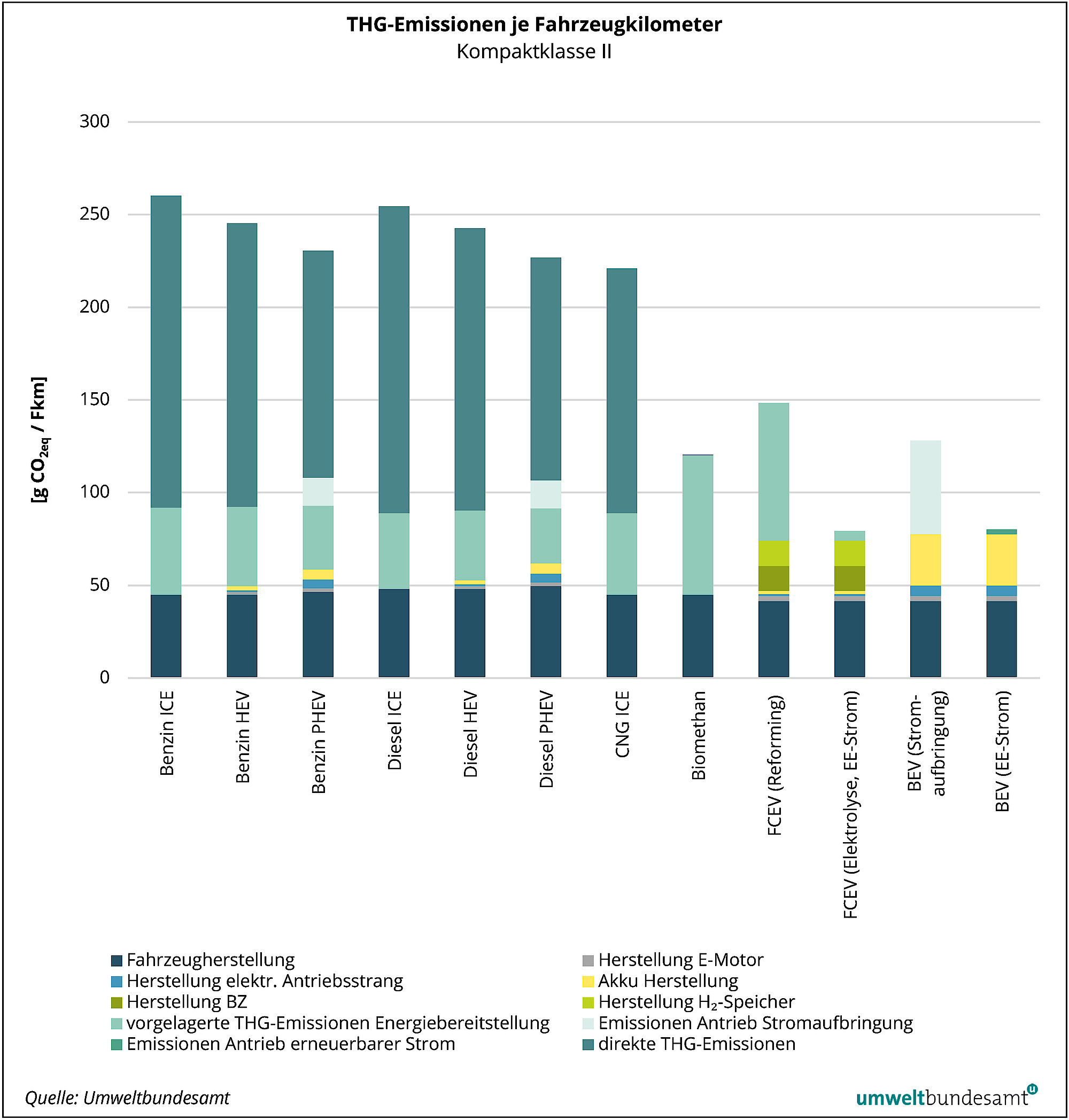 (Grafik: © Umweltbundesamt Österreich (2024), URL: https://www.umweltbundesamt.at/news210427)
(Grafik: © Umweltbundesamt Österreich (2024), URL: https://www.umweltbundesamt.at/news210427)
Alternative
Kraftstoffe
 Etwas anders gestaltet sich das Bild zu den geeigneten zukunftsfähigen
Antriebsarten für den LKW-, Schwerlast- und Fernstreckenverkehr, Schiffscargo,
Kreuzfahrten und den Flugverkehr. Ziel ist es, auf erneuerbarer Basis Kraftstoffe
herzustellen, die sich in größerem Umfang speichern lassen, um Langstrecken zu
ermöglichen. Die Kraftstoffe können aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien
hergestellt werden, gasförmig oder flüssig sein.
Etwas anders gestaltet sich das Bild zu den geeigneten zukunftsfähigen
Antriebsarten für den LKW-, Schwerlast- und Fernstreckenverkehr, Schiffscargo,
Kreuzfahrten und den Flugverkehr. Ziel ist es, auf erneuerbarer Basis Kraftstoffe
herzustellen, die sich in größerem Umfang speichern lassen, um Langstrecken zu
ermöglichen. Die Kraftstoffe können aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien
hergestellt werden, gasförmig oder flüssig sein.
Ein Syntheseweg, der bereits einen hohen technology
readiness level (= Technologie-Reifegrade in einer Skala von 1 bis 9) erreicht
hat, ist die Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Die Verfahren werden
Power-to-Liquid-Verfahren (PtL) genannt, weil mit dem Hintergrund der Nutzung
von Erneuerbaren Energien in der Regel eine Elektrolyse zur Herstellung von
Wasserstoff betrieben wird. Beim PtL-Verfahren erfolgt dann die Zusammenführung des Wasserstoffs (aus der Elektrolyse) mit CO2 (aus der Abscheidung, aus dem Direct
Air Capture) zu einem Synthesegas.
Durch weitere Prozessschritte kann ein Kerosin- oder Diesel-ähnlicher
Treibstoff hergestellt werden. Die Herstellung von Flüssigkraftstoffen aus
Synthesegas kann auf drei chemischen Wegen erfolgen: Fischer-Tropsch-Synthese, Methanol-Synthese
und Alkohol-Synthese (Ethanol, Propanol, Butanol). Eine andere Möglichkeit,
nachwachsende Rohstoffe zu Kerosin zu verarbeiten, basiert in der Ernte von
Algen in einer Algenbioraffinerie. Mit dem Ausbau der Wasserstoffwirtschaft
wird zunehmend auch der direkte Wasserstoffantrieb in Bahnen und Bussen
getestet. Die genannten Verfahren befinden sich im Pilotstadium.