Material-/Rohstoffverbrauch von erneuerbaren Energieanlagen
Auch wenn erneuerbare Energieanlagen grundsätzlich als nachhaltige Anlagetechnik einzuordnen sind, weil sie grüne Energie erzeugen, ist bei ihrer Produktion, ihrer Standortwahl, ihrem Betrieb und ihrer teilweisen Erneuerung (Repowering) bzw. endgültigen Entsorgung eine Umweltwirkung unvermeidbar. Beispielsweise verursacht der Neubau von Windkraftanlagen oder Wasserkraftwerken, z.B. auch verbunden mit dem Bau großer Staudämme, einen hohen Bedarf an Stahl und Beton. Deshalb bedarf es der tieferen Betrachtung dieser Aspekte. Erneuerbare Energieanlagen können langlebig und recycelbar gebaut werden. Es ist eine maximale Ressourcenschonung bei der Anlagenentwicklung anzustreben.
Bedeutung Treibhausintensiver Baustoffe wie Zement und Stahl
Pro Tonne Zement entsteht ein durchschnittliches Treibhausgaspotential von rund 600 kg CO
2-e in Deutschland (vgl.: VDZ/IBU 2017). Die Decarbonisierungsstrategien in der Zementherstellung befinden sich in einem frühen Pilotstadium, ein wirklicher Durchbruch von technischen Alternativen ist - mit Stand 2024 - weltweit noch nicht erreicht.
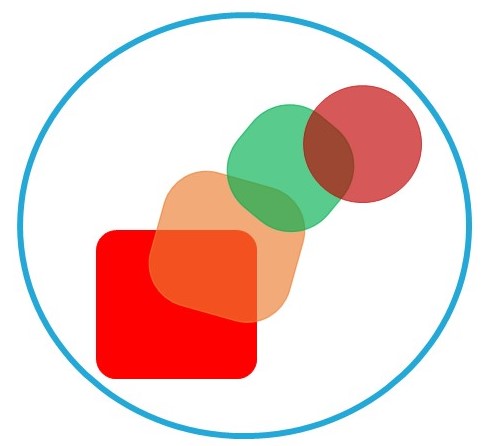 Neben der Brückentechnologie einer CO2-Abscheidung an
Zementwerken und der CO2-Nutzung über Carbon Capture and Usage Verfahren oder Abscheidung
und Lagerung über Carbon Capture and Storage wird an umweltschonenderen
Produktionsalternativen geforscht. Dazu zählt der Zementersatz durch neuartige
Bindemittel, die Recarbonatisierung durch CO2-Aufnahme in Beton, die
ressourcenschonende Nutzung von Beton in Bauwerken und der Einsatz innovativer
CO2-effizienter Zementarten (CEM II/C und CEM VI) (vgl.: VDZ 2020).
Neben der Brückentechnologie einer CO2-Abscheidung an
Zementwerken und der CO2-Nutzung über Carbon Capture and Usage Verfahren oder Abscheidung
und Lagerung über Carbon Capture and Storage wird an umweltschonenderen
Produktionsalternativen geforscht. Dazu zählt der Zementersatz durch neuartige
Bindemittel, die Recarbonatisierung durch CO2-Aufnahme in Beton, die
ressourcenschonende Nutzung von Beton in Bauwerken und der Einsatz innovativer
CO2-effizienter Zementarten (CEM II/C und CEM VI) (vgl.: VDZ 2020).
Pro Tonne Stahl entstehen konventionell ein
durchschnittliches Treibhausgaspotential von 1,5 bis 1,7t CO
2. Die Ursache
liegt überwiegend im Kokseinsatz bei der Hochofen-Konverter Route.
Bei
der Hochofen-Konverter-Route erfolgt im ersten Schritt im Hochofen die Reduktion
von Eisenerz zu Roheisen durch das Reduktionsmittel Koks. Bereits im
Hochofenprozess entsteht durch diese klassische Art der Eisenerzverhüttung sehr
viel Kohlendioxid. Im zweiten Schritt erfolgt die Stahlerzeugung in einem Stahlkonverter. Im
Stahlkonverter wird der im Roheisen enthaltene Kohlenstoff durch das sogenannte
Frischen reduziert. Beim Frischen wird der flüssige Stahl mit Sauerstoff
behandelt, der Kohlenstoff oxidiert und als CO und CO2 emittiert. Nach dem
Hochofenprozess entstehen also im Stahlkonverter erneut Treibhausgase. Der
Stahl wird durch diese Behandlung kohlenstoffarm und erhält eine hohe Reinheit.
Durch den Ersatz des Energieträgers Koks durch Grünen Wasserstoff können die
CO2-Emissionen maßgeblich reduziert werden.
Die Stahlindustrie hat die Transformation zur Produktion von Grünem Stahl bereits eingeleitet. Der Umbau der Stahlwerke für die Nutzung von Grünem Wasserstoff für die Direktreduktion anstelle von Koks erfordert hohe Investitionen, da der Hochofen für die Nutzung von Wasserstoff nicht geeignet ist und durch einen Schachtofenanlage ersetzt werden muss. Hinzu kommen eine veränderte Vorbehandlung des Eisenerzes und die Nutzung von Elektrolichtbogenöfen.