Carbon Footprint Analysen
Carbon Footprint Analysen sind ein Teil einer Ökobilanz. Anders ausgedrückt werden sie auf die Berechnung der Wirkungskategorie Treibhausemissionen, berechnet in kg CO
2-Äquivalenten (CO
2-e), beschränkt. Sie geben damit Auskunft über die Treibhausrelevanz eines Unternehmens (Corporate Carbon Footprint), dessen ausgewählte Produkte (Product Carbon Footprint) und der damit verbundenen Lieferkette.
Carbon Footprint Analysen vs. Ökobilanz
Der Grund, warum Carbon Footprint Analysen stärker an
Bedeutung gewonnen haben als Vollökobilanzen ist, dass Vollökobilanzen
aufwändiger und komplexer in ihren Aussagen sind und bis zu 15
Umweltwirkungskategorien ausweisen. Die Interpretation der Ergebnisse ist
komplex, die Vergleichbarkeit ist methodisch nicht immer gegeben. Die
Erstellung einer Ökobilanz erfordert eine umfangreiche Modellierung und
Datensammlung und fachlich ausgebildetes Personal. Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) können mangels Zeit und
Personal in der Regel keine eigenen Ökobilanzen aufstellen.
Ein weiterer Vorteil des Fokussierens auf die Berechnung des
Treibhauseffekts ist es, mit den Ergebnissen einen Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten und den jährlichen Fortschritt in der unternehmensinternen
Nachhaltigkeitsberichterstattung festzuhalten. Im Kyoto-Protokoll wurden 1997
sechs Arten von zu bilanzierenden Treibhausgasen festgelegt. Diese sind: Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid, halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe,
Fluorkohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid. Inzwischen hat der Weltklimarat
(IPCC) diese Liste um weitere Klimagase, wie z.B. Stickstofftrifluorid (NF3) (aus der
Solarzellenfertigung stammend) ergänzt.
Die Normungsanfänge für Carbon Footprint Analysen stammen aus Großbritannien. 2008 wurde die PAS 2050 (publicly available specification 2050) von der British Standards Institution (BSI) veröffentlicht, gefördert durch den Carbon Trust und das britische Umweltministerium. Danach setzte in Europa und international ein regelrechter Boom von Carbon-Footprint-Projekten ein, wie auch das bekannte PCF Pilotprojekt Deutschland, an dem namhafte Unternehmen aus Deutschland teilnahmen und Produkte aus ihrem Warenangebot einem Pilot-Product Carbon Footprint unterzogen.
Gesetzliche Regelungen
Der Carbon Footprint hat durch diese Erfahrungen erheblich an Akzeptanz in der Wirtschaft gewonnen. Er wurde bisher freiwillig erstellt. Mit dem Inkrafttreten der EU-Batterieverordnung am 18. Februar 2024 wird ab dem 28.2.2027 die verpflichtende Erklärung der CO
2-Intensität der Batteriefertigung für jede in Verkehr gebrachte LV-Batterie, Industriebatterie mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh und Traktionsbatterie in einem digitalen Batteriepass nötig (Artikel 77 Absatz 1).
Neue gesetzliche Verpflichtungen zur Carbon Footprint Analyse
bestehen ebenfalls für die berichtspflichtigen Unternehmen im Rahmen des European
Sustainability Reporting Standards (ESRS / CSRD) der Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD).
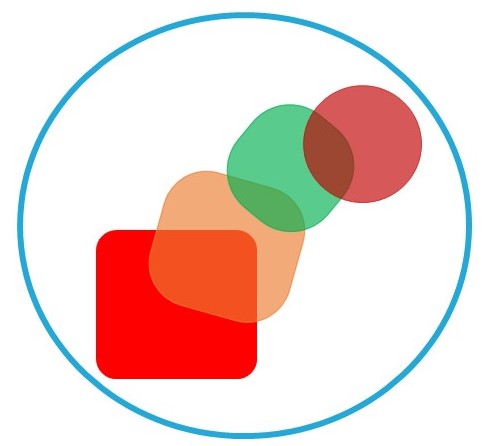 Im Rahmen der CSRD-Richtlinie wird es ab 2024 schrittweise
für immer mehr Unternehmen verpflichtend, eine CO2-Bilanz zu erstellen. Es wird
gegenwärtig intensiv an Branchen-internen und übergreifenden Datenbanken sowie einzelbetrieblichen Methoden gearbeitet, die Carbon Footprint Berechnung für
Unternehmen zu erleichtern. Hierbei spielt auch die sogenannte
Echtzeit-Datenerfassung in der Produktion eine Rolle, um in der Zukunft
Produkt-individuell einen digitalen CO2-Produktpass möglichst automatisiert
durch die Zusammenführung von Daten ausstellen zu können. Die große
Herausforderung ist die Einbindung der Zuliefererdaten, Zusammenführung von
Daten aus den Betriebs-internen Enterprise Resource Planning-Systemen und die Umsetzung in KMU. Damit
ist die CO2-Berichterstattung zum Top Thema geworden, welches die Unternehmen
noch viele Jahre beschäftigen wird und wichtiger Bestandteil der Erstellung
einer eigenen Dekarbonisierungsstrategie ist.
Im Rahmen der CSRD-Richtlinie wird es ab 2024 schrittweise
für immer mehr Unternehmen verpflichtend, eine CO2-Bilanz zu erstellen. Es wird
gegenwärtig intensiv an Branchen-internen und übergreifenden Datenbanken sowie einzelbetrieblichen Methoden gearbeitet, die Carbon Footprint Berechnung für
Unternehmen zu erleichtern. Hierbei spielt auch die sogenannte
Echtzeit-Datenerfassung in der Produktion eine Rolle, um in der Zukunft
Produkt-individuell einen digitalen CO2-Produktpass möglichst automatisiert
durch die Zusammenführung von Daten ausstellen zu können. Die große
Herausforderung ist die Einbindung der Zuliefererdaten, Zusammenführung von
Daten aus den Betriebs-internen Enterprise Resource Planning-Systemen und die Umsetzung in KMU. Damit
ist die CO2-Berichterstattung zum Top Thema geworden, welches die Unternehmen
noch viele Jahre beschäftigen wird und wichtiger Bestandteil der Erstellung
einer eigenen Dekarbonisierungsstrategie ist.