Laufwasser und Pumpenspeicherkraftwerke
Laufwasserkraftwerke werde durch die folgenden Parameter unterschieden:
- nach der Leistung,
- dem Ort ihres Einbaus und
- der Fallhöhe der Turbine:

Für den Bau von Laufwasserkraftwerken sind Flüsse mit einem
Gefälle von mehr als 2% besonders geeignet. Die Flusskraftwerke werden
unterschiedlich im Fluss positioniert, als Blockbaukraftwerk, Buchtenkraftwerk, Zwillingskraftwerk (beidseitig), Pfeilerkraftwerk (aufgelöst)
oder als überströmbares Kraftwerk (vgl.: Giesicke 2009).
Schema eines Laufwasserkraftwerkes:
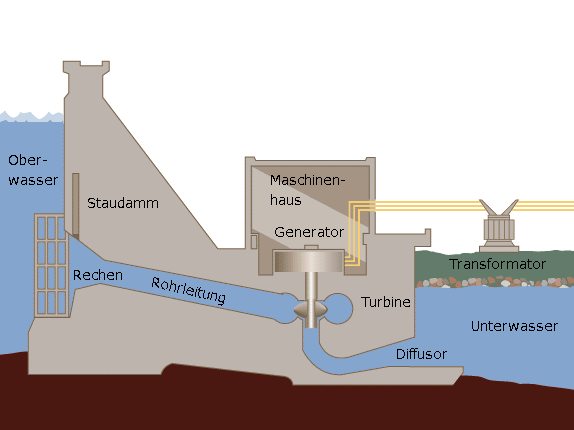
Pumpspeicher bieten eine ideale Möglichkeit, überschüssigen
grünen Strom in gespeicherte Energie (auch potenzielle Energie oder Lageenergie
genannt) umzuwandeln.
Die gespeicherte Energie kann nach Bedarf sehr kurzfristig
genutzt werden, diese Eigenschaft der Pumpspeicherkraftwerke wird
Schwarzstartfähigkeit genannt.
Geeignete Standorte für Pumpspeicherkraftwerke sind stark von geografischen Gegebenheiten, also dem Gefälle zwischen Unterbecken/Unterlauf und Oberbecken abhängig. Durch die in der Regel unterirdisch anzulegende Druckrohrleitung entstehen hohe Baukosten. Pumpspeicher werden daher entweder im Mittelgebirgsraum realisiert oder an sonstigen geeigneten Standorten mit passendem Gefälle.
Schema und Funktion eines Pumpspeicherkraftwerks:
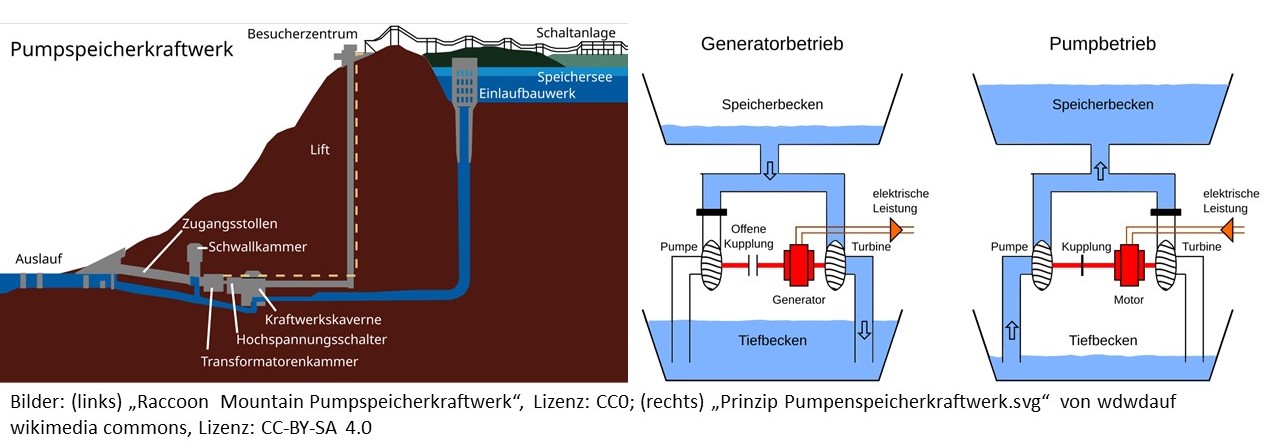
Das größte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland ist
Goldisthal im Thüringer Wald mit einer Leistung von rund 1.060 MW. Das
Goldisthaler Oberbecken umfasst 12 Millionen m³ Wasser, diese sogenannte
Lageenergie reicht für acht Stunden Turbinenbetrieb bei voller Last. Die
Fallhöhe beträgt 302 m. Neben Goldisthal sind die größten Pumpspeicherkraftwerke
in Deutschland in Markersbach (1.045 MW), das Schluchseewerk Wehr (910 MW) und
Waldeck II (480 MW) (vgl.: Statista 2024).
 Eine bisher nicht realisierte, aber interessante Variante
der Pumpspeicherkraftwerke sind mögliche Anlagen unter Tage in alten Bergwerken.
Ein ebenerdiger Obersee wird in einen außer Betrieb genommenen alten
Bergwerksschacht fallen gelassen, bei überschüssiger Energie kann dann der im
Stollen entstehende unterirdische See wieder an die Oberfläche gepumpt werden.
Im Saarland (Luisenthal, Nordschacht Lebach) wie auch im Ruhrgebiet sind bereits
vor einigen Jahren Machbarkeitsstudien für diese Form eines Pumpspeichers erstellt
worden. Die Projekte erweisen sich in der bisherigen Kalkulation als
unwirtschaftlich, aber nicht chancenlos. Das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop
(seit 2018 geschlossen) hätte laut einer Vorstudie das Potential, rund
450.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ein Gutachten errechnete Kosten in
Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro, diese seien laut Niemann (Universität
Duisburg-Essen), die aber vergleichbar mit den Baukosten oberirdischer
Speicherkraftwerke wären.
Eine bisher nicht realisierte, aber interessante Variante
der Pumpspeicherkraftwerke sind mögliche Anlagen unter Tage in alten Bergwerken.
Ein ebenerdiger Obersee wird in einen außer Betrieb genommenen alten
Bergwerksschacht fallen gelassen, bei überschüssiger Energie kann dann der im
Stollen entstehende unterirdische See wieder an die Oberfläche gepumpt werden.
Im Saarland (Luisenthal, Nordschacht Lebach) wie auch im Ruhrgebiet sind bereits
vor einigen Jahren Machbarkeitsstudien für diese Form eines Pumpspeichers erstellt
worden. Die Projekte erweisen sich in der bisherigen Kalkulation als
unwirtschaftlich, aber nicht chancenlos. Das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop
(seit 2018 geschlossen) hätte laut einer Vorstudie das Potential, rund
450.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ein Gutachten errechnete Kosten in
Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro, diese seien laut Niemann (Universität
Duisburg-Essen), die aber vergleichbar mit den Baukosten oberirdischer
Speicherkraftwerke wären.