Wasserkraft-Potenzial weltweit
Relevante Werte und Berechnungen
Die Energie, die sich aus einem Fließgewässer oder der Meeresströmung ziehen lässt, lässt sich grundsätzlich mit der folgenden Formel berechnen:

Linienpotenzial eines Laufwassers (Fließgewässers)
Je nach Abflusspotential der großen Flüsse in Deutschland (m3/s) kommt Ihnen eine entsprechende Bedeutung gemäß ihrer Strömungsgeschwindigkeit zu.
So steht an erster Stelle der Rhein: 2.330 m³/s, die Elbe: 700 m³/s, die Oder: 574 m³/s, die Weser: 300 m³/s, die Mosel: 290 m³/s, der Main: 195 m³/s und die Isar: 175 m³/s.
Das sogenannte Linienpotential wird ermittelt aus dem durchschnittlichen jährlichen Abflussvolumen der Fließgewässer und den vorhandenen Gefällen ohne Berücksichtigung der Fließverluste. Das Linienprofil beschreibt den maximalen Energievorrat eines Laufwassers.
Kraftwerksarten
Die folgenden
Kraftwerksarten werden unterschieden:
- Ein Laufwasserkraftwerk nutzt die
verfügbare Wassermenge eines Flusses oder Bachs und nutzt die über Turbinen und
Generatoren erzeugte Energie direkt zur Stromeinspeisung in das Netz.
- Speicherkraftwerke
(=Talsperren) halten das Wasser in einem Stausee zurück. Es wird dann zu Zeiten
höheren Strombedarfes durch die Turbinen geleitet.
- Pumpspeicherkraftwerke sind
eine Sonderform der Speicherkraftwerke. Hierbei wird Wasser in ein höher
gelegenes Speicherbecken gepumpt, um es bei Strombedarf nutzen zu können. Diese
Speicher können „von jetzt-auf-gleich“ gestartet werden ( auch als Schwarzstartfähigkeit bezeichnet). Das bedeutet, es wird keine
zusätzliche Energie benötigt, um das Kraftwerk auf seine volle Laufleistung zu
bringen, wie es z.B. bei Kohlekraftwerken der Fall ist.
- Meereskraftwerke: Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Meeresströmungskraftwerke.
Diese werden in den weiteren Lektionen noch näher betrachtet.
Umweltverträglichkeit von Wasserkraftwerken
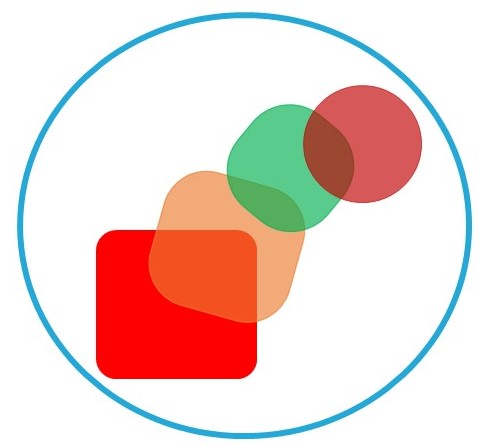 Wasserkraft ist eine saubere Technologie mit hoher
Akzeptanz. Ihr Wirkungsgrad ist mit 85-95% sehr hoch. Es handelt sich um eine
sehr ausgereifte und wenig störanfällige Technologie. Aber die stetige Verfügbarkeit
von Wasserkraft ist in heute auch vorkommenden Trockenperioden nicht mehr
selbstverständlich, deshalb kommen Pumpspeicherkraftwerken in der Energiewende
eine besondere Bedeutung zu.
Wasserkraft ist eine saubere Technologie mit hoher
Akzeptanz. Ihr Wirkungsgrad ist mit 85-95% sehr hoch. Es handelt sich um eine
sehr ausgereifte und wenig störanfällige Technologie. Aber die stetige Verfügbarkeit
von Wasserkraft ist in heute auch vorkommenden Trockenperioden nicht mehr
selbstverständlich, deshalb kommen Pumpspeicherkraftwerken in der Energiewende
eine besondere Bedeutung zu.
Die natürliche Ressource Wasser hat den großen
Vorteil der Mehrfachnutzung für die Schifffahrt, Trinkwasserversorgung, die
Fischzucht, die Kühlwassernutzung und die Energiegewinnung. Dieses setzt aber voraus,
dass die menschengemachten Probleme der Extremwetterlagen mit stark
beeinträchtigen Flussläufen nicht weiter zunehmen.
Nachteile
der Wasserkraftnutzung sind unter anderem die zum Teil hohen Investitionen beim Bau.
Beispiel
Die im Rahmen der Energiewende in Deutschland jüngst
geplanten Pumpspeicher an Mosel (Trier) und Rhein (Heimbach) wurden wegen zu
hohen finanziellen Risiken bisher nicht gebaut. Für heutige Anlagen mit einer Leistung
zwischen 100 kW und 100 MW sind Investitionen für den Neubau von etwa 6.860
€/kW nötig (Quelle: VDEW).
Das größte Wasserkraftwerk in Deutschland
(Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal) hat eine installierte Leistung von rund 1.060
MW und liegt in Thüringen. Das größte Laufwasserkraftwerk Deutschlands ist das
Rheinkraftwerk Iffezheim in Baden-Württemberg. 6.900 der rund 7.200 Wasserkraftwerke
in Deutschland arbeiten in einem Leistungsbereich von unter 1 MW und zählen zu
den Kleinstwasserkraftwerken.
Standorte und Flächen
Ganz generell wirken Wasserkraftanlagen auf den Menschen und die Umwelt vor allem dann, wenn der Bau von Staudämmen oder Pumpspeicherbecken den Verlust von Siedlungsgebieten des Menschen (Zwangsumsiedlungen) oder von Waldflächen im Mittelgebirge zur Folge hat.
Berühmtes Beispiel in Europa ist das Anstauen des Reschensees in Südtirol im Jahr 1950, denen die Ortschaften Graun, Teile von Reschen und weitere kleine Ortschaften zum Opfer fielen. Insgesamt 677 ha, verbunden mit der Zwangsenteignung, Aus- und Umsiedlung von Bürgern. Das Kirchlein in Alt-Graun ragt heute als touristisches Wahrzeichen aus dem See. Eine Ausstellung vor Ort erinnert an die eher düstere Vergangenheit der Flutung der Ortschaften.

Bild "Reschensee with Graun Church tower and boart.jpg" von Noclador auf wikimedia commons, Lizenz: CC-BY-SA 4.0
Bei großen Staudammprojekten wie am Drei-Schluchten-Staudamm in China oder dem Bau des Itaipú-Staudammes in Brasilien/Paraguay sowie vielen Projekten weltweit wurde der starke Eingriff in die Landschaft durch den Menschen realisiert. Landschaften und Kleinklimaverhältnisse werden mit diesen Großprojekten unwiederbringlich verändert. Es gilt jedoch auch, die großen Vorteile der hohen und langfristigen Erzeugungspotentiale großer Wasserkraftanlagen abzuwägen. So erzeugt das Wasserkraftwerk am Itaipú-Staudamm mit einer Leistung von 14 GW so viel Elektrizität wie zehn frühere Atomkraftwerke in Summe.
Handelt es sich um das Anstauen von grenzüberschreitenden Flussläufen, so hat es in der Vergangenheit und bis heute häufig Konflikte um die Wassernutzung zwischen den betroffenen Anrainerstaaten gegeben (z.B.: Nil, Jordan).
Zusätzliche Flächenerschließungen für Pumpspeicher in
bewaldeten Mittelgebirgshöhenlagen haben heute häufig eine geringe Akzeptanz,
wenn ihr Bau das Abholzen von Waldgebieten und den Verlust von wertvollen
Lebensräumen verursacht. So gab es beispielsweise ein Aus für die Planung eines
Pumpspeicherkraftwerks im Hotzenwald/Schwarzwald, vor allem aus ökologischen
Gründen. Neue Pumpspeicherkraftwerks-Standorte sind daher nicht
einfach zu finden.