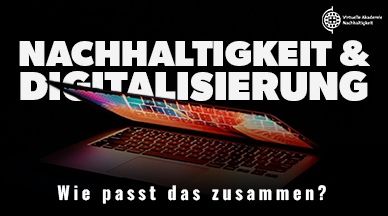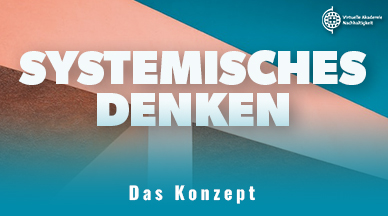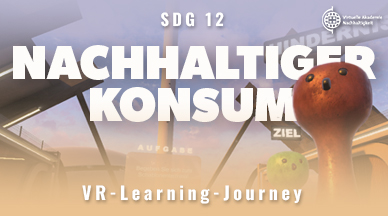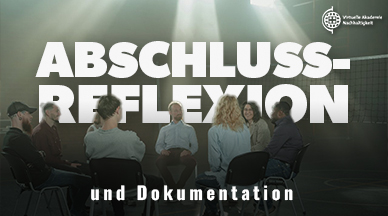Systemdenken und Nachhaltigkeit in Virtual Reality
Kurs: Systemdenken und Nachhaltigkeit in Virtual Reality | OnCourse UB
-
Wahrnehmung aus systemischer Perspektive
-
Lern- und Erkundungsziel von Lektion 2:
Nach Abschluss von Lektion 2 können Sie die wesentlichen Annahmen zur systemischen Wahrnehmung zusammenfassen. Außerdem können Sie die Funktionsweise der menschlichen Informationsverarbeitung nach der Theorie der sozialen Kognition wiedergeben und einordnen, welche Bedeutung mentale Schemata für systemisches Arbeiten hat.

@pixabay - kostenlose Nutzung
-
Systemische Perspektive auf Grundlage von Entwicklungsgesetzmäßigkeiten
Die systemische Wahrnehmung, wie sie hier verstanden wird, will einen Weg weg von einer binären Perspektive auf Systeme aufzeigen, bei der bei der ein „nicht-wünschenswerter Zustand“ durch einen „wünschenswerten Zustand“ abgelöst wird (vom Ist- zum Soll-Zustand).
Stattdessen soll hier das Verständnis geprägt werden, dass jede Entwicklung einer Logik folgt, dessen Hintergrund die Bewältigung von Komplexität ist (siehe dazu auch Kapitel 5).
Heißt also, um ein System lesen zu können, muss dessen externe Komplexität bewältigt werden. Dies kann gelingen, indem die eigene interne Komplexität zugelassen und gestaltet wird. Systeme lesen zu lernen als Voraussetzung um deren Entwicklung zu ermöglichen – das ist auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der vielfältigen und komplexen 17 SDGs relevant.„Alle Systeme sind einer gewissen Umweltkomplexität ausgesetzt, auf die sie sich mehr oder weniger stimmig ausrichten können und die sie durch ihr Handeln permanent steigern. Zunehmende Komplexität braucht dann einen Entwicklungsschritt, der es ermöglicht, mehr Außenkomplexität zu bewältigen.“ (Müller-Christ & Pijetlovic, 2018, S. 12)
Holarchie- und Serendipitätsprinzip als Grundlagen erkundender Haltung:
Das Holarchieprinzip beschreibt das Zusammenspiel zwischen Teilen und Ganzem und folgt dabei der Logik einer kumulativen Anreicherung. Zu bestehenden Aspekten, die sich im System bewährt haben, kommt dabei stetig etwas Neues hinzu. Auf diese Art und Weise ergibt sich ein neuer Zustand des Bewährten. Dieser Prozess des Hinzufügens und der Integration des neu hinzugefügten wiederholt sich stetig.
Im Rahmen des Holarchieprinzips wird weiterhin davon ausgegangen, dass eine Vielzahl dieser Entwicklungsprozesse gleichzeitig ablaufen, woraus sich ein Allgemeinzustand hoher Komplexität im System ergibt. Entwicklungen innerhalb eines Systems gehen demnach stets mit einem Bestreben nach Komplexitätsbewältigung einher:
Gleichzeitig erzeugt ein System durch das eigene Verhalten wiederum neue Umweltkomplexität, der es sich erneut anpassen muss. Diese Entwicklungslogik im Sinne des Holarchieprinzips folgt also einem fortlaufenden Kreislauf bestehend aus den Phasen: Einheit, Ausdifferenzierung, Reintegration, Einheit auf dem nächsthöheren Niveau und wieder von vorn. Entsprechend dieses Prinzips wäre jedes Ganze Teil eines größeren Ganzen von neuer Qualität (und Komplexität).Will ein System sich weiterentwickeln, so muss es sich der gegebenen Umweltkomplexität anpassen, um sie zu bewältigen.
Systemische Erkundungsarbeit folgt dem Bestreben, des jeweils beobachtete System zu verstehen und Neues darüber zu erfahren. Dies geschieht, dem Serendipitätsprinzip entsprechend, in einem ergebnisoffenen Prozess, der die Bereitschaft der Erkundenden voraussetzt, sich von Wahrnehmungen irritieren zu lassen und Unerwartetes auszuhalten ohne es als richtig oder falsch zu bewerten.
Der Erkundungsprozess fokussiert demnach die Entdeckung von Überraschendem oder Unbekannten.Serendipitätsprinzip: Suchen wird als zielorientierter und Finden als ergebnisoffener Prozess betrachtet.
Systeme lesen zu lernen ist Voraussetzung, um deren Entwicklung zu ermöglichen – das ist grade in den aktuellen Zeiten des Wandels, der Schnelllebigkeit und Ungewissheit und den damit einhergehenden komplexen Themen relevant (auch vor dem Hintergrund der Erreichung der vielfältigen und komplexen 17 SDGs).
„Die Qualität der Erkenntnisse bei der Beobachtung von Systemen hängt von der Qualität des Bewusstseins der Beobachtenden ab.“
-
Systeme durch Paradigmenwechsel verändern:
Ein Schlüsselereignis, um eine tiefgreifende Veränderung innerhalb eines Systems anzuregen ist nach Meadows die Erkenntnis, dass kein Paradigma, also keine Erklärungsmodell, das einzig wahre bzw. richtige ist. Die mit dieser Erkenntnis einhergehende Flexibilität und Ungebundenheit gegenüber Paradigmen kann bereits Veränderungsprozesse innerhalb von Systemen initiieren.
Damit aber ein komplexes System das eigene Verhalten nachhaltig ändern kann, muss es neben seiner Struktur und unmittelbarer Umgebung auch sein eigenes Handeln aus der tiefsten Ebene seines Selbst heraus verstehen (siehe dazu das Eisbergmodell der Systemebenen von Müller-Christ = Ordnungsmodell wie Systeme mithilfe von Erkundungsaufstellungen analysiert werden können). Durch eine Betrachtung der eigenen Systemebenen kann einem System (z.B. ein Unternehmen) eine bessere Ordnung bzw. Bewältigung innerer Widersprüche gelingen.
Spannungsfelder und Dilemmata in Sozialen Systemen:
Spannungsfelder: Aus systemischer Sicht handelt es sich dabei um eine Metapher um zu beschreiben, dass
a) Spannungen in Form von Energie Bewegungen überhaupt erst ermöglichen und
b), dass es in einem Spannungsfeld Kräfte und Gegenkräfte gibt.
Im systemischen Kontext entstehen Spannungsfelder in sozialen Systemen durch unvereinbare Kräfte, die gleichzeitig wirken und berücksichtigt werden müssen, ein solcher Zustand kann auch als Dilemma beschrieben werden.
Grundspannung in sozialen Systemen entsteht durch Polarität von Zwecken und Mitteln, denn: ein soziales System gibt es nur, weil es einen Zweck verfolgt; und zur Erreichung dieses Zwecks müssen entsprechende Mittel eingesetzt werden.
Dilemmata erkennt man logisch immer am Trade-off (ähnlich wie: "Preis").
Die dilemmatischen Polaritäten folgen einer Sowohl-als-auch-Logik, um dies aushalten zu können, muss das Denksystem eines Individuums auf eine höhere Komplexitätsstufe transformiert werden, da hier eine hohe Ambiguitätstoleranz vorausgesetzt wird.
Häufige Spannungsfelder, die in der systemischen Arbeit beobachtet werden (und die Trade-Offs verursachen) sind: Freiheit vs. Zwang (Vertrauen vs. Kontrolle); Zwecke vs. Mitte (Nachhaltigkeit vs. Effizienz; Instrumentalisierung vs. Eigenwert).
Bewältigung von Dilemmata und Trade-offs
Dilemmata lassen sich im Gegensatz zu Konflikten nicht lösen oder vermeiden, sondern sie können nur bewältigt werden. Am Ende einer Dilemmaentscheidung steht ein Trade-off, der nach einem Ausgleich verlangt.
Intuitive Wahrnehmung und die Erweiterung mentaler Landkarten im Rahmen systemischer Arbeit
Im folgenden Abschnitt geht es um das Thema Wahrnehmung, die Rolle von mentalen Skripten und Schemata dabei und wie eine erkundende Haltung bei der Weiterentwicklung der eigenen mentalen Landkarten unterstützen kann.
Theorie der Sozialen Kognition zur menschlichen Informationsverarbeitung
Die „Soziale Kognition beschreibt das menschliche Denken über sich selbst und die eigene soziale Welt.“
Diese Theorie beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Menschen Informationen verarbeiten, interpretieren und erinnern. Die Theorie der Sozialen Kognition geht davon aus, dass menschliche Denk- und Entscheidungsprozesse durch kognitive Schemata beeinflusst werden. Diese Schemata setzen sich aus Skripten (Handlungsmustern) und Einstellungen zusammen, welche auf vom Individuum gemachten Erfahrungen beruhen. Diese Schemata ermöglichen es Menschen, bestimmte Erwartungen über (mögliche) Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu treffen. Schemata fungieren also als eine Art Simulation von Entscheidungskonsequenzen.
Diese Schemata könnten auch als mentale Landkarten umschrieben werden, sie weisen dem Individuum den Weg (Verhalten) durch die erlebte Situation, anhand von (in der Vergangenheit) gesetzten Wegmarkierungen (Erfahrungen). Somit beeinflussen mentale Schemata die Wahrnehmung und Interpretation von Informationen, die Erwartungen an eine Situation, die Art und Weise des Denkens (z.B. automatisiert/implizit oder kontrolliert/explizit) und schlussendlich auch das gezeigte Verhalten.
HIER KOMMT NOCH EINE ABBILDUNG HIN
Kognitive Schemata:
Diese Abläufe menschlicher Informationsverarbeitung können durch systemische Übungen bewusst irritiert werden und damit den Weg zu neuen Erkenntnissen ebnen.Definition Schemata: Schemata sind allgemeingültige mentale Wissensstrukturen über Objekte und Konzepte.
Durch räumliche Visualisierungen von Themen könnte die Fähigkeit zur Vorhersage von Handlungskonsequenzen gestärkt werden. Sollten bei systemischen Übungen irritierende, neue oder unerwartete Momente auftreten, können die bestehenden mentalen Modelle (Landkarten) erweitert und so zukünftig bessere Vorhersagen für Handlungskonsequenzen getroffen werden. Grund dafür ist, dass die bestehenden kognitiven Schemata in der Regel sehr stabil sind. Sie werden erst dann geändert, wenn zahlreiche widersprüchliche Informationen wahrgenommen werden, sodass die bestehende Erwartung/Hypothese die kognitive Konstellation nicht mehr ausreichend erklärt und sich eine alternative Erwartung als zutreffender herausstellt. So kann mithilfe systemischer Übungen und dem Fokus auf systemischer Wahrnehmung ein Vorstoß zu neuen mentalen Modellen gelingen, welcher das Potential für innovative und kreative Lösungsansätze birgt.
@pixabay - kostenlose NutzungDas menschliche Bewusstsein strebt zudem permanent danach dem Erlebten einen Sinn, bzw. eine innere Logik zu verleihen. Es sucht nach Mustern und greif dafür auch auf implizite (unbewusste) Theorien zur subjektiven Realitätsabbildung zurück. Solche impliziten Theorien beinhalten Zusammenhangs- und Organisationsstrukturen von bestimmten Merkmalen und deren kausale Verknüpfung untereinander. Zur Beschreibung und Erklärung ihrer eigenen Lebensrealität nutzen Menschen also ein individuelles Bewertungssystem. Aus dieser Logik heraus ergibt sich auch das Phänomen der erwartungskongruenten Bewertung von Informationen und damit der Bestätigungsfehler (confirmation bias). Menschen neigen häufig dazu, neue Informationen so zu interpretieren, dass sie deren eigene Erwartungen bestätigen (also sinnhaft in bestehende kognitive Bewertungssysteme eingeordnet werden kann), da dies mit einer (als angenehm empfundenen) Komplexitätsreduktion der Informationsverarbeitung einhergeht.
Im Kontext von systemischen Übungen, wie beispielsweise Systemaufstellungen (siehe Kapitel 5), ist der Ausbruch aus vorhandenen Strukturen explizit gewünscht. Die Beteiligten sollen bewusst zur Irritation und Interpretation eingeladen werden, um so die Entstehung neuer Ideen zu forcieren.
-
-
Fazit: Jede Entwicklung in einem System folgt zunächst dem Bestreben nach Bewältigung von gegebener Umweltkomplexität, ganz im Sinne des Holarchieprinzips. Es beschreibt den Prozess einer stetigen Anreicherung im System: zu bestehenden bewährten Systemaspekten kommen stetig neue Aspekte hinzu und werden integriert. Die systemische Erkundungsarbeit definiert im Rahmen des Serendipitätsprinzips ‚Suchen‘ als zielorientierten und ‚Finden‘ als ergebnisoffenen Prozess, bei dem die Bereitschaft zur Irritation zentral ist. Diese Offenheit auch gegenüber eines Paradigmenwechsels kann bereits Veränderungsprozesse innerhalb eines Systems anregen. Im Kontext der Theorie der Sozialen Kognition der Wahrnehmung wird deutlich, dass Menschen häufig auf Grundlage bestehender Schemata und daraus antizipierten Erwartungen Entscheidungen treffen. Durch systemische Übungen können diese Abläufe der Informationsverarbeitung bewusst irritiert werden und der Weg zu neuen Erkenntnissen geebnet werden.
-