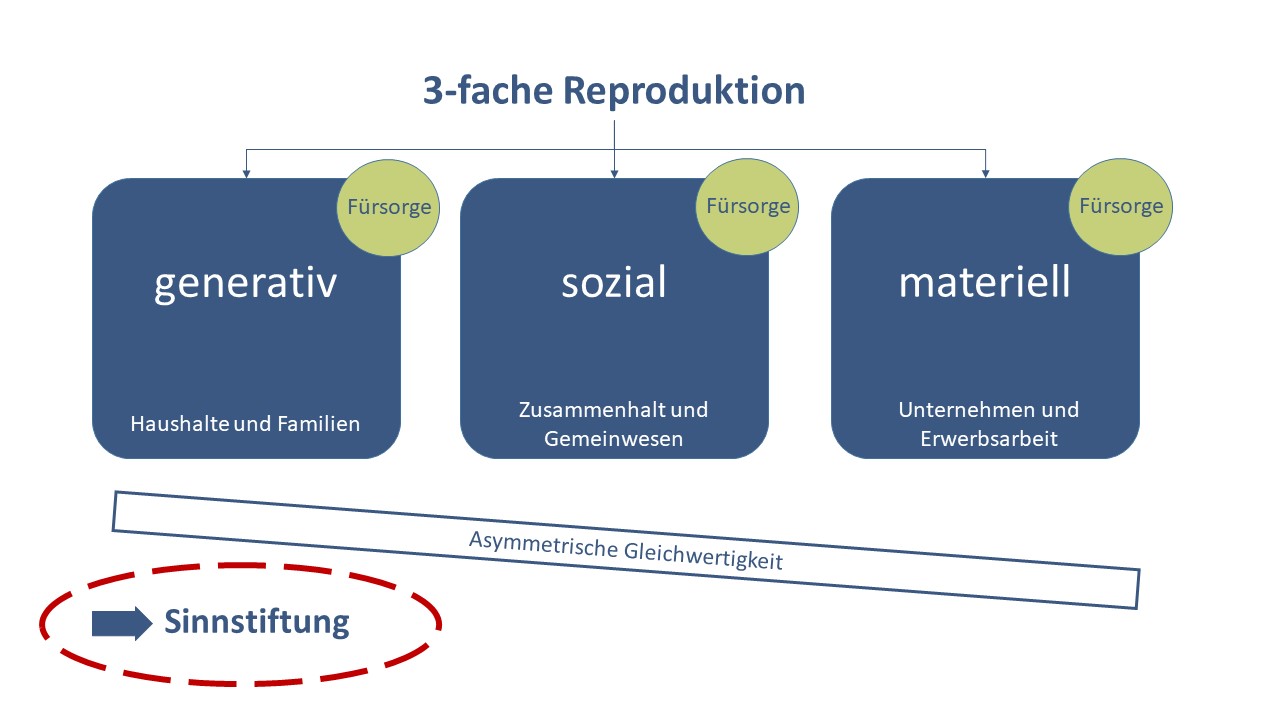Sind alle Bereiche gleich viel
wert?
Wir sind es
gewohnt, die materielle Reproduktion in Form der ökonomischen Leistungen als
wichtigstes Feld zu betrachten, weil es den gegenwärtigen Diskurs scheinbar
alternativlos durchzieht. Auf dieser Überzeugung haben wir unser soziales
Sicherungssystem aufgebaut (dazu werden wir in Lektion 5 noch mehr erfahren)
und so hat es sich auch als Leitlinie in unsere Lebensentwürfe eingeschrieben. Wird
man zum Beispiel auf einer Party darauf angesprochen, was man mache, antwortet
man wie selbstverständlich mit seinem Beruf.

Systematisch
aber basiert die Annahme der herausgehobenen Bedeutung der Erwerbsarbeit auf
einem doppelten Irrtum: Denn…
- erstens sind alle drei Bereiche gleichwertig in
ihrer Bedeutsamkeit für die Reproduktion.
- zweitens kann man sogar von einer asymmetrischen
Gleichwertigkeit sprechen im Hinblick darauf, welche Bedingungen die
Bereiche bereitstellen, um Handeln überhaupt zu ermöglichen, also hinsichtlich
ihrer konstitutiven Stellung.
Aus dieser Perspektive erweist
sich die Sphäre der ökonomisch
vermittelten Arbeitsleistung als nachgeordnet gegenüber familiären und
gemeinwohlbezogenen Tätigkeiten. Denn Familien und Beiträge zum Gemeinwesen
gehen der ökonomischen Wohlstandsproduktion voraus.
Arbeitsleistung und Wertschöpfung
setzen Menschen voraus, die es gelernt haben, sich im sozialen Feld zu bewegen,
eine Idee von Leistung und Wert erfahren sowie sich notwendige Qualifikationen
angeeignet haben und sich an das Gemeinwesen binden können, indem sie
Verantwortung empfinden und Solidarität üben.
Solche Entwicklungswege jedes
Einzelnen beruhen auf einem funktionierenden Gemeinwesen und auf Familien, in
denen Kinder Vertrauen entwickeln und sich bedingungslos angenommen fühlen.
Und was ist jetzt mit der Kohärenz? Und was ist damit überhaupt
gemeint?
Wenn man dieser
Argumentation folgt, stellt sich sofort die Frage, wie denn nun gewährleistet
werden kann, dass die Handlungsentscheidungen der Individuen den Erfordernissen
einer gesellschaftlich nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Diese Entsprechung
lässt sich auch als Kohärenz bezeichnen.
Wichtig
Die Antwort lautet:
Kohärenz
stellt sich her, wenn die Handlungsbedingungen sowie die Werte und
Überzeugungen der Individuen zu den gesellschaftlichen Anforderungen passen.
Wir müssen uns also mit diesen Handlungsbedingungen und Überzeugungen befassen und werden darüber dann später zu den nötigen und möglichen Änderungen kommen für eine Stärkung sozialer Nachhaltigkeit. Doch zunächst noch einmal zurück zum Strukturmodell von Gesellschaft für einen tieferen Blick auf das Wechselverhältnis zwischen Struktur und Handeln. Damit wird dann auch die in der Abbildung noch enthaltene Sinnstiftung erläutert.